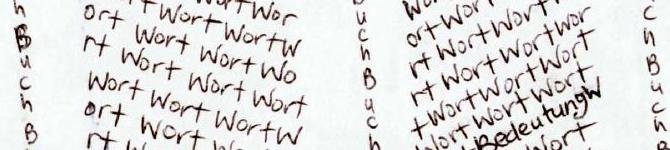An den Bärtigen
Ich wünsche mir, dass wir das Staunen wiederfinden
Ich umrandete gerade meine Augen zum dritten Mal mit Kajal, als ich den Schlüssel im Schloss hörte. Sofort sprang ich auf und fiel ihm dankbar um den Hals, dass er endlich nach Hause kam. Den ganzen Nachmittag verbrachte ich mit mir selbst und meinen kreisenden Gedanken. Ich wollte nicht telefonieren, ich wollte nicht einkaufen gehen, ich wollte nicht aufräumen, sondern ich überließ mich den verrinnenden Minuten, ohne Musik, ohne Fernsehen. Starrte nur an die weiße Wand und unterhielt mich mit mir selbst. Wurde wütend über meine Untätigkeit, über meine Lustlosigkeit, über die ewig wiederkehrenden Fragen. Habe zuviel geraucht und Kaffee getrunken, in alten Briefen gebadet und verlorenen Gefühlen hinterher getrauert. Und nun kam er endlich von der Arbeit, um mich wieder lebendig zu machen. Seine Augen waren leer und dunkel, doch ich ignorierte seine Müdigkeit, überschüttete ihn mit meinen hervorbrechenden Worten, die ihn überforderten und auslaugten. Ich überredete ihn zu einem Spaziergang, weil ich gierig danach war, Menschen zu sehen, ihre Lebendigkeit aufzusaugen und auf mein Dasein zu übertragen. Damit meine eigene Farblosigkeit nicht zu sehr auffiel, mischte ich mich unter junge Menschen, hörte laute Musik und schlürfte genauso stilvoll meinen Milchkaffee vor den Augen fremder, unwichtiger Leute, immer auf den Schein der Dinge bedacht. Schöne Schale pflegen, nichts anderes zählt, auf die Höflichkeitsfloskeln hast Du gefälligst richtig und ja nicht zu aufdringlich zu reagieren. Ich schleppte ihn hinaus, in dieses vorgegaukelte Leben, keine Rücksicht nehmend auf seine Bedürfnisse, auf seine Müdigkeit, auf die traurigen Geschichten, die ihm heute widerfuhren. Er hatte sich meinem Überlebenskampf anzupassen und mich zu unterstützen. Ich war grausam und egoistisch, doch das wusste er, bevor er einwilligte, mich bei ihm einziehen zu lassen.
Endlich saßen wir in seinem Auto und fuhren in die Schanze. Es war ein warmer Sommerabend und ich hatte, um ihn zu ärgern, meine Tussischuhe angezogen. Er mochte natürliche Frauen, keine klackernden, kichernden Kulleraugenmädls, die Männer mit oberflächlichem Geschwätz und Wimpernklimpern in ihren Bann zogen. Doch manchmal machte es so unendlich viel Spaß, so zu sein. So selbstbewusst und männermordend wirkend. Denn er kannte mich ohnehin anders. Er bekam meine Höhen- und Sturzflüge mit diversen Männern hautnah mit, frühstückte immer wieder mit anderen und musste mich oft genug am Telefon verleugnen. Und viel zu oft Tränen trocknen. Und ich rechne ihm all die Nächte hoch an, in denen er an meinem Bett saß, mit mir irgendein blödes DVD sah und Wodka trank. Immer wieder die gleiche Leier musste er sich anhören, nur mit wechselnden Protagonisten. Ich war Profi darin, mich in Illusionen zu verlieben und zu schnell mit Männern ins Bett zu gehen. Ich weiß nicht mehr, was ich mir davon erhoffte. Ich wollte nicht alleine schlafen, ich wollte mein Selbst vergessen, aber wenn sie mir, diesem inneren, zerbrechlichen, unsicheren Wesen, zu nahe kamen, versteifte sich die mühsam aufrechterhaltene Maske und ich war wiedermal eine gefeierte Schauspielerin, die sich selbst am meisten damit weh tat. Und alles verlor, was ich anfasste. Er betrachtete wortlos, vorwurfsvollfrei, mein seltsames Spiel um das Glück und fing mich immer wieder auf. Ich habe mich noch nie bei ihm dafür bedankt. Doch was sollte ich auch sagen?
Also schlenderten wir übers Schulterblatt, holten uns Eis und setzten uns auf die Stufen vor der Roten Flora. Ich lehnte meinen Kopf an seine Schulter und er erduldete es, so wie alles andere, mein lautes Lachen, meinen Wortschwall, meine sekündlichen Stimmungswechsel. Wir betrachteten die vorübergehenden Menschen und die Vorführkarren, ich erzählte ihm von meinen üblichen emotionalen Verwirrungen und plötzlich sagte er, ihm fehle das Staunen. Nichts explodiere mehr im Herzen. Ich sah ihn von der Seite an, sein Blick schweifte desinteressiert über den Schulterblatt-Laufsteg und meine eben noch ausgespuckten Worte machten sich beschämt, gebückt davon. Ich widerstrebte dem Impuls, ihn am Nacken zu streicheln, starrte zurück auf mein tropfendes Eis und schluckte schwer an seinen Worten. Ich hab mich selten gefragt, wie es ihm wohl ging, denn alles schien immer in Ordnung zu sein, unter Kontrolle, so ganz anders als bei mir. Um ihn Sorgen zu machen wäre doch verschwendete Energie gewesen.
Ihm fehle das Staunen. Alles sei schon mal passiert, und damals intensiver, lebendiger, strahlender. Größer, tiefer, echter. Und heute ist alles nur noch ein billiger Abklatsch der Emotionen von früher. Mit diesen wenigen Worten schaffte er, was Alkohol, Sex und Drogen vergeblich versuchten: ich war von mir selbst, von diesem ewigen egozentrischen Kreisen abgelenkt, musste innehalten und mich einer anderen Person zuwenden, eine Person, die mir mehr wahrhaftige Liebe zukommen ließ als alle anderen, die ich in den letzten Monaten traf. Das Staunen. Wo ging es hin? Wie haben wir es verscheucht? Und wie können wir es wieder zurückholen? Als ich auf den Asphalt und meine Zehen, wie immer schwarzrot lackiert, starrte, schweifte er über zu einem anderen Thema, aber so leicht wollte ich ihn nicht entkommen lassen, dazu war dieses Gespräch zu wichtig. Weil es an mir zehrte. Die Gedanken in mir tobten und ich brauchte lange, einen Satz zu formulieren. Wie ein Kind zerrte ich am Ärmel seines Pullis und stammelte Fragezeichen. Das Staunen. Das alles lebenswert macht, das Sinn gibt, durch den grauen Brei der Tage zu tauchen.
Und ich wollte schreien, inmitten all der Menschen. Wollte ihnen entgegenlaufen, ihre Schultern schütteln, atemlos fragen, wann sie das letzte Mal für etwas gebrannt haben, ob sie jemals um ihr Glück, um Liebe, um Menschen gekämpft haben, ob sie wahrhaftig sind, ob sie wissen, wer sie seien und welche Fähigkeiten in ihnen stecken. Und dann besann ich mich. Ich sollte mir selbst diese Fragen stellen. Ich war selber tot. Mir fehlte selber jegliches Staunen. Wer hat es mitgenommen?
Ich umrandete gerade meine Augen zum dritten Mal mit Kajal, als ich den Schlüssel im Schloss hörte. Sofort sprang ich auf und fiel ihm dankbar um den Hals, dass er endlich nach Hause kam. Den ganzen Nachmittag verbrachte ich mit mir selbst und meinen kreisenden Gedanken. Ich wollte nicht telefonieren, ich wollte nicht einkaufen gehen, ich wollte nicht aufräumen, sondern ich überließ mich den verrinnenden Minuten, ohne Musik, ohne Fernsehen. Starrte nur an die weiße Wand und unterhielt mich mit mir selbst. Wurde wütend über meine Untätigkeit, über meine Lustlosigkeit, über die ewig wiederkehrenden Fragen. Habe zuviel geraucht und Kaffee getrunken, in alten Briefen gebadet und verlorenen Gefühlen hinterher getrauert. Und nun kam er endlich von der Arbeit, um mich wieder lebendig zu machen. Seine Augen waren leer und dunkel, doch ich ignorierte seine Müdigkeit, überschüttete ihn mit meinen hervorbrechenden Worten, die ihn überforderten und auslaugten. Ich überredete ihn zu einem Spaziergang, weil ich gierig danach war, Menschen zu sehen, ihre Lebendigkeit aufzusaugen und auf mein Dasein zu übertragen. Damit meine eigene Farblosigkeit nicht zu sehr auffiel, mischte ich mich unter junge Menschen, hörte laute Musik und schlürfte genauso stilvoll meinen Milchkaffee vor den Augen fremder, unwichtiger Leute, immer auf den Schein der Dinge bedacht. Schöne Schale pflegen, nichts anderes zählt, auf die Höflichkeitsfloskeln hast Du gefälligst richtig und ja nicht zu aufdringlich zu reagieren. Ich schleppte ihn hinaus, in dieses vorgegaukelte Leben, keine Rücksicht nehmend auf seine Bedürfnisse, auf seine Müdigkeit, auf die traurigen Geschichten, die ihm heute widerfuhren. Er hatte sich meinem Überlebenskampf anzupassen und mich zu unterstützen. Ich war grausam und egoistisch, doch das wusste er, bevor er einwilligte, mich bei ihm einziehen zu lassen.
Endlich saßen wir in seinem Auto und fuhren in die Schanze. Es war ein warmer Sommerabend und ich hatte, um ihn zu ärgern, meine Tussischuhe angezogen. Er mochte natürliche Frauen, keine klackernden, kichernden Kulleraugenmädls, die Männer mit oberflächlichem Geschwätz und Wimpernklimpern in ihren Bann zogen. Doch manchmal machte es so unendlich viel Spaß, so zu sein. So selbstbewusst und männermordend wirkend. Denn er kannte mich ohnehin anders. Er bekam meine Höhen- und Sturzflüge mit diversen Männern hautnah mit, frühstückte immer wieder mit anderen und musste mich oft genug am Telefon verleugnen. Und viel zu oft Tränen trocknen. Und ich rechne ihm all die Nächte hoch an, in denen er an meinem Bett saß, mit mir irgendein blödes DVD sah und Wodka trank. Immer wieder die gleiche Leier musste er sich anhören, nur mit wechselnden Protagonisten. Ich war Profi darin, mich in Illusionen zu verlieben und zu schnell mit Männern ins Bett zu gehen. Ich weiß nicht mehr, was ich mir davon erhoffte. Ich wollte nicht alleine schlafen, ich wollte mein Selbst vergessen, aber wenn sie mir, diesem inneren, zerbrechlichen, unsicheren Wesen, zu nahe kamen, versteifte sich die mühsam aufrechterhaltene Maske und ich war wiedermal eine gefeierte Schauspielerin, die sich selbst am meisten damit weh tat. Und alles verlor, was ich anfasste. Er betrachtete wortlos, vorwurfsvollfrei, mein seltsames Spiel um das Glück und fing mich immer wieder auf. Ich habe mich noch nie bei ihm dafür bedankt. Doch was sollte ich auch sagen?
Also schlenderten wir übers Schulterblatt, holten uns Eis und setzten uns auf die Stufen vor der Roten Flora. Ich lehnte meinen Kopf an seine Schulter und er erduldete es, so wie alles andere, mein lautes Lachen, meinen Wortschwall, meine sekündlichen Stimmungswechsel. Wir betrachteten die vorübergehenden Menschen und die Vorführkarren, ich erzählte ihm von meinen üblichen emotionalen Verwirrungen und plötzlich sagte er, ihm fehle das Staunen. Nichts explodiere mehr im Herzen. Ich sah ihn von der Seite an, sein Blick schweifte desinteressiert über den Schulterblatt-Laufsteg und meine eben noch ausgespuckten Worte machten sich beschämt, gebückt davon. Ich widerstrebte dem Impuls, ihn am Nacken zu streicheln, starrte zurück auf mein tropfendes Eis und schluckte schwer an seinen Worten. Ich hab mich selten gefragt, wie es ihm wohl ging, denn alles schien immer in Ordnung zu sein, unter Kontrolle, so ganz anders als bei mir. Um ihn Sorgen zu machen wäre doch verschwendete Energie gewesen.
Ihm fehle das Staunen. Alles sei schon mal passiert, und damals intensiver, lebendiger, strahlender. Größer, tiefer, echter. Und heute ist alles nur noch ein billiger Abklatsch der Emotionen von früher. Mit diesen wenigen Worten schaffte er, was Alkohol, Sex und Drogen vergeblich versuchten: ich war von mir selbst, von diesem ewigen egozentrischen Kreisen abgelenkt, musste innehalten und mich einer anderen Person zuwenden, eine Person, die mir mehr wahrhaftige Liebe zukommen ließ als alle anderen, die ich in den letzten Monaten traf. Das Staunen. Wo ging es hin? Wie haben wir es verscheucht? Und wie können wir es wieder zurückholen? Als ich auf den Asphalt und meine Zehen, wie immer schwarzrot lackiert, starrte, schweifte er über zu einem anderen Thema, aber so leicht wollte ich ihn nicht entkommen lassen, dazu war dieses Gespräch zu wichtig. Weil es an mir zehrte. Die Gedanken in mir tobten und ich brauchte lange, einen Satz zu formulieren. Wie ein Kind zerrte ich am Ärmel seines Pullis und stammelte Fragezeichen. Das Staunen. Das alles lebenswert macht, das Sinn gibt, durch den grauen Brei der Tage zu tauchen.
Und ich wollte schreien, inmitten all der Menschen. Wollte ihnen entgegenlaufen, ihre Schultern schütteln, atemlos fragen, wann sie das letzte Mal für etwas gebrannt haben, ob sie jemals um ihr Glück, um Liebe, um Menschen gekämpft haben, ob sie wahrhaftig sind, ob sie wissen, wer sie seien und welche Fähigkeiten in ihnen stecken. Und dann besann ich mich. Ich sollte mir selbst diese Fragen stellen. Ich war selber tot. Mir fehlte selber jegliches Staunen. Wer hat es mitgenommen?
Brizz - 14. Nov, 09:28